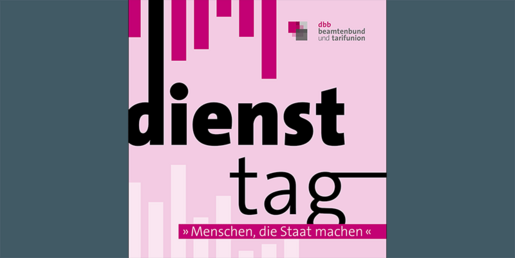dbb VerkehrstagStrategien gegen den Sanierungsstau
FWSV, VC, GDL, VDStra.: Die dbb Fachgewerkschaften schlagen Alarm, in Sachen Infrastruktur besteht enormer Handlungsbedarf. Deutschland muss wieder in Bewegung kommen.
Deutschland muss wieder in Bewegung kommen – dies ist auch das Motto des dbb Verkehrstags, der am 2. Juni 2025 in Berlin stattfindet. Schienen, Weichen und Stellwerke sind marode, die Bahn verzeichnet Negativrekorde, was die Pünktlichkeit betrifft. Beziehungsweise: Rekorde in Unpünktlichkeit. 2024 kamen laut Bahnstatistik 37,5 Prozent der Fernzüge mehr als sechs Minuten zu spät – zu bedenken ist, dass ausgefallene Züge nicht in die Statistik eingehen. Jüngst hat die Schweizer Bundesbahn (SBB) im Grenzverkehr – von der Unpünktlichkeit der Nachbarn genervt – zwei Verbindungen nach Deutschland gekappt. Auf den Autobahnen sieht es nicht besser aus. Baustellen, kaputte Straßen und Brücken bremsen den Verkehr aus. Pendlerinnen und Pendler starten und schließen ihren Berufsalltag im Stau, in der Logistik verursacht jede Stunde Wartezeit finanzielle Verluste. LKW müssen Ausweichstrecken nutzen; oftmals Straßen, die nicht für tonnenschwere Fahrzeuge ausgelegt sind. Die Folgen: noch mehr kaputte Straßen. Und von Lärm geplagte Anwohnerinnen und Anwohner in Ortschaften, die unter dem vermeintlich vorübergehenden Durchfahrten leiden.
„Die Probleme in der Infrastruktur sind nicht bloß eine Belastung für die Wirtschaft, sie tragen auch ganz wesentlich dazu bei, dass das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates sinkt“, sagt Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender des dbb. Laut der dbb Bürgerbefragung 2024 halten 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger den Staat für überfordert. Silberbach: „Ich gehe nicht davon aus, dass wir aktuell einen besseren Wert verzeichnen würden, im Gegenteil. Von der neuen Bundesregierung erwarte ich, dass sie alles unternimmt, um die Probleme in Griff zu bekommen. Das ist ein wesentlicher Baustein, um das Vertrauen der Menschen und der Wirtschaft in die Handlungsfähigkeit des Staates zurückzugewinnen!“
Was steht im Koalitionsvertrag?
Union und SPD wollen die offenen Baustellen angehen: „Wir werden mit Investitionen in die Infrastruktur dafür sorgen, dass die Bahn wieder pünktlich fährt, die Straßen und Brücken wieder in einem guten Zustand sind“, heißt es im Koalitionsvertrag. Die finanzielle Grundlage hierfür soll das Sondervermögen für die Infrastruktur bilden, das sich auf 500 Milliarden Euro beläuft. Die Koalitionäre wollen bei der Planungs- und Baubeschleunigung „mutige Wege gehen“. Damit meinen sie unter anderem Bürokratieabbau und die Beschleunigung von Verwaltungsvorgängen. Der Koalitionsvertrag listet verschiedene Stellschrauben: Es soll „ein einheitliches Verfahrensrecht (…) für Infrastrukturvorhaben“ geben; zudem wollen Union und SPD formalisierte Verfahren flexibilisieren, Verfahrensstufen reduzieren und Doppelprüfungen abbauen. Nicht zuletzt erklären die Parteien: Der „identische, der erweiterte und der vollseitige Ersatzneubau bei Infrastrukturvorhaben soll von der Pflicht eines Planfeststellungsverfahrens ausgenommen“ und die Plangenehmigung zum Regelverfahren werden. Ergo: Grundsätzlich soll es künftig schneller und einfacher zugehen.
Im dbb sind mit der Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten (VDStra.), der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), dem Fachverband Wasserstraßen- und Schifffahrtverwaltung (FWSV) sowie der Pilotenvereinigung Cockpit (VC) gleich vier Organisationen vertreten, die Infrastrukturthemen kritisch begleiten und ihre Expertise einbringen. Egal, ob auf Straße, Schiene, Wasser oder in der Luft – das Ziel aller ist es, eine dauerhafte, auskömmliche und gemeinwohlorientierte Finanzierung im Sinne einer leistungsfähigen Infrastruktur sicherzustellen.
„Private Investitionen bringen zwangsläufig private Interessen mit sich, die diesem Ziel widersprechen“, sagt dbb Chef Silberbach. „Deshalb sollten staatliche Aufgaben nur durch staatliche Mittel finanziert werden.“
Ob das mit der Mehrheit von Union, SPD und Grünen vor dem Regierungswechsel beschlossene Sondervermögen von 500 Milliarden Euro ausreicht? Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln ist skeptisch: Allein bis 2030 bestehe ein Investitionsbedarf in die Verkehrsinfrastruktur von mehr als 100 Milliarden Euro jährlich. Die Berechnung veröffentlichte das IW im Oktober 2024. „Wenn das Geld nicht reicht, muss sich die Politik unbedingt rechtzeitig um Folgefinanzierungen Gedanken machen, damit wir keine Zeit verlieren“, unterstreicht Silberbach. Außerdem erwartet der Bundesvorsitzende, dass die Merz-Regierung die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Verkehrsträger schnellstmöglich konkretisiert. Dabei dürfe es keine Ellenbogenmentalität geben: „Was wir brauchen, ist eine integrierte Betrachtung. Die Infrastruktur ist ein Gesamtkonstrukt, in der vieles ineinandergreift und jeder Verkehrsträger seine Daseinsberechtigung hat“ – das äußert sich zum Beispiel darin, dass Wasser- und Schienenverkehr dazu beitragen, den Güterverkehr auf den Straßen zu reduzieren, wodurch sich der Materialverschleiß verringert und die Klimabilanz verbessert.
Doch losgelöst von der Gesamtbetrachtung sehen die Verkehrsträger auch Großbaustellen, die vor allem ihre eigenen Zuständigkeiten betreffen. Nachfolgend beziehen sie Stellung.
Straße: Mauteinnahmen für die Autobahn GmbH
Das steht im Koalitionsvertrag: „Die Autobahn GmbH wird begrenzt kreditfähig und ihr werden Lkw-Mauteinnahmen zur Verfügung gestellt (Einnahmekompetenz). Für die Straße werden Finanzmittel zur Auflösung des Sanierungsstaus insbesondere bei Brücken und Tunneln zur Verfügung gestellt. Es wird geprüft, wie sich die Autobahn GmbH dauerhaft stabil finanzieren kann. Eine umfassende parlamentarische Kontrolle der Mittel wird gewährleistet.“
So kommentiert die Fachgewerkschaft: „Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Bundesregierung Mauteinnahmen der Autobahn GmbH zur Verfügung stellen will“, sagt Hermann-Josef Siebigteroth, Vorsitzender der VDStra. Die Mittel seien dringend notwendig und es sei nur konsequent, sie in den Bau und die Instandhaltung der Autobahnen und Bundesstraßen zu investieren. Längst überfällig seien auch Investitionen in Ausstattung und Personal. Aktuell sei es nicht möglich, alle offenen Stellen zu besetzen, was die Beschäftigten stark belastet. „Immer weniger Schultern müssen immer mehr Arbeit stemmen“, beklagt Siebigteroth. Um die Personallücke zu schließen, müsse sich der öffentliche Dienst schneller an die sich verändernden Realitäten auf dem Arbeitsmarkt anpassen. Das gilt mit Blick auf die Flexibilisierung von Arbeitszeiten, Digitalisierung, Entlohnung sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Insgesamt müsse folgendes Credo gelten: „Wer rechtzeitig Risse in Straßen fachgerecht verschließt, braucht sich später nicht um Schlaglöcher kümmern.“
Auch die im Koalitionsvertrag angekündigte Prüfung der Finanzierung der Autobahn GmbH kommentiert der VDStra.-Vorsitzende: „Das Ergebnis ist noch vollkommen offen, trotzdem möchte ich schon jetzt unterstreichen, dass wir eine Privatisierung der Infrastruktur ablehnen.“ Es müsse stets gewährleistet sein, dass Finanzmittel direkt in den Bau und die Instandhaltung der Straßen fließen. „Aufwändige Vertragsverhältnisse mit externen Dienstleistern verursachen schon jetzt zu hohe Verwaltungskosten.“
Schiene: Bahnreform aufs Gleis bringen
Das steht im Koalitionsvertrag:„Um sicherzustellen, dass das Geld des Bundes künftig bei der Schieneninfrastruktur ankommt, (…) , wollen wir mittelfristig eine grundlegende Bahnreform umsetzen. Wir werden die DB InfraGO vom DB-Konzern weiter entflechten, innerhalb des integrierten Konzerns. (…) Der Fortbestand des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags (BEAV) zwischen DB-Konzern und InfraGO wird geprüft. (…) Das Trassenpreissystem reformieren wir.“
So kommentiert die Fachgewerkschaft: „Die aktuelle Konzernstruktur verhindert den Ausbau der Infrastruktur“, sagt GDL Chef Mario Reiß. „Mit den Folgen kämpfen die Menschen, die mit Verspätungen und Ausfällen konfrontiert sind, tagtäglich“ – deshalb sei eine Bahnreform mehr als überfällig. Die GDL fordert, das gesamte Schienennetz, die Bahnhöfe und alle weiteren Infrastruktureinheiten, darunter die DB Energie, aus dem Konzern herauszulösen und in eine Gesellschaft der öffentlichen Hand zu überführen. „Aktuell kann der Konzern Gelder hin- und herschieben, wie es ihm gerade passt“, kritisiert Reiß. „Eine zielgerichtete Verwendung öffentlicher Mittel sieht anders aus, Investitionen werden aufgeschoben und versickern im Konzern“ – um das künftig zu verhindern, fordert die GDL die Gründung einer GmbH öffentlichen Rechts oder einer anderen Rechtsform unterhalb des Bundesverkehrsministeriums, das die Planung, Steuerung und Kontrolle staatlicher Investitionen übernimmt. Die Bahnreform selbst soll eine Regierungskommission beaufsichtigen.
Was der GDL ebenfalls ein Dorn im Auge ist: die stark steigenden Trassenpreise, die jährlich neu festgelegt werden. Es handelt sich um die Kosten, die Wettbewerber der Bahn für die Nutzung des Schienennetzes zahlen. „Faktisch beinhalten die Trassenpreise sämtliche Ausgaben des Infrastrukturbetreibers DB“, sagt Reiß. Es sei absurd, dass ein Unternehmen seinen Wettbewerbern die eigenen Betriebs- und Verwaltungskosten aufbürden könne. „Das muss die Politik dringend ändern!“
Wasserstraße: Künftig volles Potenzial ausschöpfen
Das steht im Koalitionsvertrag:„Für die Ertüchtigung der Infrastruktur aus Wasserstraßen, Schleusen, See- und Binnenhäfen werden wir für notwendige Investitionen eine auskömmliche zusätzliche Finanzierung mit Planungssicherheit organisieren. Dafür wird ein Finanzierungs- und Realisierungsplan entwickelt. Wir unterstützen weiterhin die Transformation der Wasserstraßen und Häfen. Die Nationale Hafenstrategie wird umgesetzt.“
So kommentiert die Fachgewerkschaft: „Ich hoffe, dass sich unsere Vorstellungen von notwendigen Investitionen mit denen von Union und SPD decken“, betont Egon Höfling, Bundesvorsitzender des Fachverbands Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (FWSV). Im Koalitionsvertrag werde zwar von „Ertüchtigung der Infrastruktur“ gesprochen, doch was das genau beinhalten soll, bleibt vage. Dreh- und Angelpunkt ist für den FWSV eine ausreichende Finanzierung in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Höfling: „Wir müssen alles dafür tun, um die Wahrnehmung der Wasserstraßen in der Öffentlichkeit zu verbessern, denn in ihnen schlummert enormes Potenzial“ – beispielsweise mit Blick auf den grenzüberschreitenden Warenverkehr, der Erschließung neuer Transportgüter und der Anbindung an andere Verkehrsträger. Erreichen lässt sich dieses Ziel durch konsequente Digitalisierung, bei der zu gründende Innovationszentren für Wassertransport eine Rolle spielen könnten, Bürokratieabbau sowie bessere Arbeitsbedingungen, um Fachkräfte zu gewinnen.
Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung kümmert sich um einen reibungslosen Schiffverkehr auf bundesweit 7 300 Kilometer Binnenwasserstraße und 23 000 km² Seewasserstraße. Teil der Infrastruktur sind unter anderem mehr als 300 Schleusen- und Wehranlagen, Sturmflutsperrwerke und diverse Brücken. „Nur wenn alles in Schuss ist, können die Bundeswasserstraßen ihrer Rolle als Rückgrat der deutschen Wirtschaft gerecht werden“, sagt Höfling. Rund zwei Drittel des deutschen Im- und Exports werden über die Seehäfen abgewickelt. Um dies auch künftig zu gewährleisten, haben sich Bund und Länder bereits in der Nationalen Hafenstrategie darauf verständigt, die Häfen zukunftsfähig zu machen. Höfling resümiert: „Die Strategie ist ein wichtiger Baustein, um Planungen, deren Realisierung sowie Finanzierungen sicherzustellen.“
Luft: Drehkreuze und Fernflughäfen an die Schiene bringen
Das steht im Koalitionsvertrag:„Die luftverkehrsspezifischen Steuern, Gebühren und Abgaben wollen wir reduzieren und die Erhöhung der Luftverkehrsteuer zurücknehmen. Die über das EU-Maß hinausgehende Power-to-Liquid-Quote (PzL) schaffen wir sofort ab. (PtL ist ein Verfahren, um flüssige Kraftstoffe aus Strom herzustellen, der aus regenativen Quellen stammt; Anmerkung der Redaktion) Wir sorgen dafür, dass Europäische Fluggesellschaften bei der Sustainable-Aviation-Fuels-Quote (SAF) nicht schlechter gestellt werden als außereuropäische. Die Hälfte der nationalen Einnahmen aus dem luftfahrtinduzierten europäischen Emissionshandel (ETS 1) wollen wir zur Förderung der Marktimplementierung von SAF verwenden.“ (SAF = Nachhaltiger Luftfahrttreibstoff, Anmerkung der Redaktion)
So kommentiert die Fachgewerkschaft: „Wir begrüßen ausdrücklich, dass die neue Bundesregierung die Luftverkehrsteuer zurücknehmen möchte“, sagt Andreas Pinheiro, Präsident der Pilotenvereinigung Cockpit (VC). Denn nationale Sonderbelastungen sollten aus gewerkschaftlicher Sicht zugunsten internationaler, wettbewerbsneutraler Instrumente – beispielsweise einer europäischen Klimaabgabe – reduziert werden. Für die Förderung und Marktimplementierung von SAF erhofft sich Pinhero mehr konkrete Zusagen: Der Bund müsse durch das nationale Luftfahrt-Forschungsprogramm (LuFo) eine verlässliche Finanzierung für Forschung und Entwicklung sicherstellen. Außerdem seien Mittel aus dem Klimatransformationsfonds (KTF) erforderlich, um Produktionskapazitäten und Distributionsinfrastruktur aufzubauen.
Es gibt weitere Themen, die der Koalitionsvertrag nicht erwähnt, die aber dennoch für die Vereinigung Cockpit eine große Bedeutung haben. „Um die Position der Pilotinnen und Piloten zu stärken, ist ein umfassender Regulierungsrahmen notwendig, der marktverzerrende Strukturen und Tarifflucht verhindert“, unterstreicht Pinhero. Und um die Verkehrswende voranzutreiben, gelte es, die Schienenanbindung der Flughäfen auszubauen – vor allem an Langstreckenflughäfen und Drehkreuzen. cdi