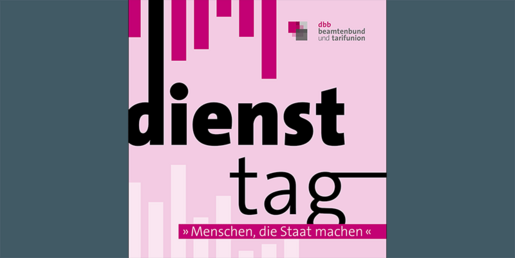Europäischer Abend„Das Berufsbeamtentum ist ein Bollwerk gegen den Extremismus“
Liberale Demokratien sind weltweit unter Druck. Damit Deutschland stabil bleibt, braucht es unter anderem einen starken öffentlichen Dienst.
Zum Auftakt des Europäischen Abends am 8. Juli 2025 (Thema: „Deutschlands Beitrag zur Wehrhaftigkeit der Demokratie“) stellte dbb-Chef Volker Geyer klar: „Zur Demokratie gehören mehr als Wahlen. Es geht um funktionierende Gewaltenteilung, unabhängige Justiz, eine freie Presse, eine lebendige Zivilgesellschaft – und einen starken öffentlichen Dienst. Gerade wir als Gewerkschaften wissen: Ohne kompetente, verfassungstreue Beschäftigte im Staatsdienst ist Demokratie nicht wehrhaft.“ Beamtinnen und Beamten leisteten sogar einen Diensteid, der sie auf das Grundgesetz verpflichtet. Nicht nur deshalb gelte, so Geyer: „Das Berufsbeamtentum ist ein Bollwerk gegen den Extremismus.“
Der öffentliche Dienst müsse insgesamt gestärkt werden, in Deutschland und in Europa. Geyer: „Lehrerinnen und Lehrer, Polizistinnen und Polizisten, Verwaltungsmitarbeitende – sie sichern den Alltag unserer Demokratie. Sie stehen für Recht statt Willkür. Und sie tun das in einem Klima wachsender Bedrohung durch Desinformation und Populismus. Deshalb brauchen sie mehr denn je verlässliche Rahmenbedingungen und politischen Rückhalt. Und auch wenn sich Aufgaben durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verändern: Die Demokratie lässt sich nicht automatisieren. Der öffentliche Dienst lebt von den Beschäftigten und ihrer Haltung.“
Bedrohungen sind inakzeptabel
Stefanie Hubig, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, unterstrich in ihrem Impulsvortrag ihr Vertrauen in die Menschen im Staatsdienst: „Der öffentliche Dienst und das Berufsbeamtentum sind in besonderer Weise geeignet, die Demokratie zu verteidigen.“ Gerade der lebendige Rechtsstaat sei mit der lebendigen Demokratie untrennbar verbunden.“ Auch die Regierung müsse sich an Gesetze halten und andernfalls „von einer unabhängigen Justiz in die Schranken gewiesen werden“ können. Derzeit werde die Gewaltenteilung aber immer häufiger in Frage gestellt – nicht nur international, sondern auch in Deutschland.
In der Folge seien bei Gerichten nach Entscheidungen über die viel diskutierten Zurückweisungen an der Grenze zu Polen sogar Hassbotschaften und konkrete Drohungen eingegangen. Hubig erklärte dazu: „Ich sage ganz klar: Die Bedrohung von Richterinnen und Richtern ist vollkommen inakzeptabel. Das gilt selbstverständlich auch für alle anderen Beschäftigten der Gerichte, für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Justizvollzugs. Die Herrschaft des Rechts muss gerade dann gelten, wenn es politisch unbequem ist.“
Um die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland zu stärken, verwies die Ministerin auf die geplante Neuauflage des „Pakts für den Rechtsstaat“, den die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern anstrebt. Ziel sei es, die Justiz besser auszustatten – sowohl personell als auch in Hinblick auf die Digitalisierung. Gleichzeitig sei aber auch die Politik gefordert, bei der Lösung von Problemen besser zu werden. „Ob ein Staat funktioniert, merken die Bürgerinnen und Bürger im Alltag“, so die Ministerin. Deshalb plane die Regierung eine Reihe von Maßnahmen, um das Leben der Menschen einfacher und bezahlbarer zu machen, etwa durch die Verlängerung der Mietpreisbremse und besseren Schutz vor Hass im digitalen Raum.
Paneldiskussion: Europa ist Teamsport
Der Berliner Staatsrechtler Prof. Dr. Christian Calliess sieht dringenden Handlungsbedarf, um die Demokratie in Europa besser abzusichern. Dabei unterscheidet er zwei Ebenen: die europäische und die nationale. „Wir blicken auf zwei Ebenen der Demokratiesicherung: einmal auf EU-Ebene. Die Extremisten sitzen im Parlament und kommen in die verschiedenen Ämter. Hier müssen wir uns die Frage stellen, wie sich die EU dagegen absichern kann“, betonte Calliess. Anders als im nationalen Recht gebe es auf europäischer Ebene keine Instrumente wie ein Parteiverbot. Gleichzeitig stelle sich auf nationaler Ebene die Frage, welche Rolle die EU dabei spiele, die Resilienz ihrer Mitgliedstaaten zu stärken. Ein zentrales Problem sieht Calliess im Vollzug europäischen Rechts: „Die Leute wollen sehen, dass die EU funktioniert. Wir müssen europäisches Recht mit Leben und Glaubwürdigkeit füllen. Es geht um das Recht im Alltag. Darum, dass die Mitglieder das Recht, das die EU beschließt, auch durchsetzen.“
Besonders schwierig sei die Frage, wer eigentlich festlegt, wann Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verletzt werden. „Wenn Mitgliedsländer einen Rechtsrahmen verlassen, wer definiert diesen Rahmen? Wer definiert, wann Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verletzt werden?“, fragte Calliess. Die Entwicklung einer europäischen Verfassungsgerichtsbarkeit sei ein wichtiger Schritt gewesen. Doch je tiefer man in die politische Debatte einsteige, desto komplizierter werde es. „Denn was gehört eigentlich zum Kern der Demokratie?“ Calliess warnte zudem vor falschen Erwartungen an die EU. „Die EU ist kein Bundesstaat, die Mitgliedschaft ist freiwillig. Das haben uns auch die Briten gezeigt. Wir brauchen deshalb eine gute Balance zwischen Freizügigkeit, Funktionalität und Steuerung“, erklärt er. Wichtig sei, dass die Bürgerinnen und Bürger die Steuerung aus Brüssel nicht als Fremdsteuerung empfänden. „Wir dürfen nicht erwarten, dass die EU ganz Europa in Ordnung bringt. Dafür sind die 27 Mitgliedstaaten zu verschieden.“
Trotz aller Schwierigkeiten plädierte Calliess für Reformen und einen offenen Diskurs: „Ein gemeinsamer Wertekompass ist eine schöne Sache, sie darf sich allerdings nicht gegen Europa wenden. Die EU wird mit ihrer aktuellen Struktur die Probleme nicht lösen können. Deshalb müssen wir Europa neu denken.“ Die Union habe kaum Zwangsgewalt, daher müsse man über neue Instrumente wie mögliche Ausschlüsse nachdenken. „Wir brauchen klare Kriterien, wann Rechtsstaatlichkeit verletzt wird und welche Maßnahmen greifen. Darüber braucht es einen europäischen Dialog. Nur so kann die EU ihre Glaubwürdigkeit halten. Es gibt viel zu diskutieren, aber das ist machbar. Wir können diesen Weg gehen und wir sollten ihn gehen.“
Auch Roland Theis MdB, Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Europaausschuss, betonte: „Das Recht alleine kann die Demokratie nicht schützen.“ Vielmehr müsse Politik das Leben der Menschen konkret im Alltag verbessern, um das Vertrauen in die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu erhalten. „Hinzu kommt: Dinge, die man für selbstverständlich hält, meint man nicht verteidigen zu müssen.“ Das gelte für viele Menschen hinsichtlich der Demokratie ebenso wie für die Errungenschaften der Europäischen Union. Hier habe er aber bereits ein verändertes Bewusstsein gerade bei jungen Menschen festgestellt: „Zwischen den Europawahlen 2019 und 2024 gab es einen Quantensprung beim Bewusstsein für den Wert der demokratischen Prozesse, auch in Europa.“
Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Britta Haßelmann, hat angesichts aktueller Herausforderungen mehr Geschlossenheit und einen klaren Wertekompass in der Europäischen Union gefordert. „Wir haben einen enormen Nachholbedarf, haben aber in den 27 EU-Ländern keinen Konsens“, erklärte Haßelmann. Als Beispiel nannte sie Ungarn: „Wir müssen uns fragen, ob in Zukunft Rechtsstaatlichkeit an Zahlungen aus der EU geknüpft ist.“
Haßelmann plädierte dafür, die Menschen stärker für das europäische Projekt zu gewinnen. „Wir müssen gemeinschaftlich aktiver sein. Wie können wir die Energie und Begeisterung für die EU nutzen? Viele fragen sich, was die EU konkret in ihrem Alltag bedeutet“, sagte sie. Es gehe darum, verständlich zu vermitteln, was Europa leiste: „Wenn ich über Finanzplanung und Green Deal rede, hole ich die Leute nicht ab. Aber wenn ich über Europäische Freizügigkeit spreche, dann gewinne ich die Herzen und das Gehör der Leute.“ In einer Zeit, in der Ex-Präsident Trump mit „America First“ eine Politik der Abschottung propagiert habe, müsse Europa ein klares „Europe United“ entgegensetzen.
Besorgt zeigte sich Haßelmann zudem über Angriffe auf die kritische Infrastruktur und die Verbreitung von Desinformation. „Wir sind nicht ausreichend vor Desinformation geschützt. Jeden Tag finden Angriffe auf die kritische Infrastruktur statt“, warnte sie. Vor diesem Hintergrund forderte sie eine gemeinsame Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa. „Putins Krieg geht nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen Frieden in Europa. Ein gemeinsamer Wertekompass ist daher zwingend notwendig.“
Mit Blick auf das Verhalten einiger Mitgliedstaaten in der Vergangenheit übte sie Kritik: „Im Fall Ungarns haben die 26 anderen Staaten zu lange zugesehen, ob die Geschehnisse mit ihren Werten übereinstimmt. Allerdings haben wir bei Polen gesehen, dass der Diskurs über Werte fruchten kann.“ Deshalb dürfe die EU hier „nicht zu viel Zurückhaltung zeigen“.
Kritisch äußerte sich Haßelmann auch in Richtung CDU-Chef Friedrich Merz. Sie widersprach der Einschätzung, er sei ein großer Europäer: „Bei Friedrich Merz besteht hinsichtlich Europa Nachholbedarf.“ Gerade mit Blick auf den Streit über Grenzkontrollen und den Verweis auf Artikel 72 warnte sie vor Alleingängen: „Was 40 Jahre nach dem Schengen-Abkommen passiert, hätte auch Helmut Kohl erschreckt. Wir haben uns auf Artikel 72 berufen, ohne das mit den anderen Ländern abzustimmen. Nun haben wir die Antwort von Polen. Das schreckt mich sehr, denn das widerstrebt der europäischen Idee.“
Dr. Anna-Maija Mertens, Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland, verwies auf eine repräsentative Forsa-Umfrage. Demnach gibt knapp die Hälfte der Befragten in Deutschland an, zwar an der Europäischen Union interessiert zu sein, jedoch die Arbeitsweise der einzelnen EU-Institutionen nicht zu verstehen. 80 Prozent halten die EU für wichtig, fühlen sich aber gleichzeitig nicht „mitgenommen“.
„Wir müssen Europa und die Rolle Deutschlands in Europa besser erklären“, forderte Mertens. Andernfalls, so warnte sie, „lassen wir den Platz frei für die, die Europa zerstören wollen.“ Mit Blick auf Mitgliedsländer mit Rechtsstaatsdefiziten wie Ungarn sprach sie sich für eine „Koalition der Willigen“ aus, um eine „strukturierte Integration“ zu ermöglichen. Die deutsch-finnische Politikerin kritisierte die deutsche Praxis der Stimmenthaltungen in den vergangenen Jahren, das sogenannte „German Vote“. Dieses Vorgehen schade Europa, weil kleinere EU-Mitgliedsstaaten wie Finnland gezwungen seien, abzuwarten, wie Deutschland sich entscheide. Stattdessen brauche es Führung und Klarheit – etwa in Fragen der Verteidigung. Finnland habe es beispielsweise für notwendig gehalten, entlang der russisch-finnischen Grenze mit sogenannten Push-backs auf russische Provokationen zu reagieren. Diese Provokationen hätten darauf abgezielt, das Land und die EU durch das gezielte Einschleusen von Migranten zu destabilisieren. Finnland habe dabei bewusst gegen EU-Recht verstoßen. Wenn es um Sicherheit gehe, müssten die Europäer kohärenter zusammenarbeiten. „Und damit müssen wir jetzt anfangen.“
Gosia Binczyk, stellvertretende Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, erläuterte, was die Arbeit der Kommission im Kern ausmacht: Die Priorität liege klar auf dem Schaffen und Durchsetzen eines Rechtsrahmens für die Zusammenarbeit – eines Rahmens, der mit Leben gefüllt werden müsse. Ihr selbst, die noch im Polen des Kriegsrechts aufgewachsen sei, sei es quasi in die Wiege gelegt worden, die Demokratie als etwas zu begreifen, das man schützen müsse, weil man es liebe. Bei jungen Menschen sei dieses Bewusstsein womöglich nicht mehr so ausgeprägt. Deshalb gebe es Initiativen, die an Schulen gehen, Pixibücher zum Thema „Demokratie“ und – für Teenager – sogar das Computerspiel „Fabulous Council“, das zeige, „was es bedeutet, Kompromisse zu finden“.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit sei die Bekämpfung von Desinformation, etwa durch die Stärkung des Journalismus oder die Entwicklung von Planspielen für Schulen, die dabei helfen sollen, Desinformation zu erkennen. Als Sanktionierungsinstrument gegenüber Staaten, in denen sich undemokratische Tendenzen zeigen, habe die EU-Kommission nur die Möglichkeit, EU-Mittel zurückzuhalten. Der mehrjährige Finanzrahmen der Kommission sei es, „der die Worte der EU in Geld gießt“, sagte Binczyk.
„Europa ist Teamsport“, betonte sie weiter und wies – wie auch Mertens – darauf hin, dass Deutschland als Land mit dem größten Stimmanteil mit einer Politik der Stimmenthaltungen kleinere Staaten mit nur wenigen Stimmen mitunter in Bedrängnis bringe. Binczyk erinnerte an ihre Erfahrungen als Teilnehmerin an den TTIP-Verhandlungen vor einigen Jahren: „Man muss erklären: Was verteidigen wir und warum verteidigen wir es.“ Nur so könne man Angriffe auf die Demokratie von außen wie von innen abwehren.
Lilian Schwalb, Geschäftsführerin beim Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE), warnte in ihrem Schlusswort: „Zivilgesellschaftliches Engagement ist Angriffen ausgesetzt, international, aber auch in Deutschland. Hier stellt sich die Frage: Wo beginnt legitime Kontrolle, wo beginnt politische Einschüchterung. Da müssen wir alle gemeinsam wachsam zu sein, denn eine lebendige Zivilgesellschaft ist der beste Schutz für die Demokratie.“